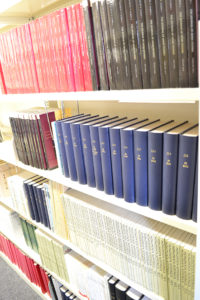… mag manch einer glauben, der für ein Referat oder eine Hausarbeit recherchiert. Warum sollte man den Gang vom heimischen Schreibtisch in eine Bibliothek auf sich nehmen, wenn man doch alles von zu Hause aus recherchieren und lesen kann? Außerdem ist es doch Papier- und damit Ressourcenverschwendung, wenn Informationen gedruckt, aber niemals in dieser Form gelesen werden. Die Bücher stehen doch einfach nur rum und verstauben. Alles irgendwie richtig. Und dennoch hat auch die Japanologie eine Bibliothek, die aufwendig gepflegt und mit aktuellen Büchern bestückt wird.

Foto: Sonja Hülsebus
Also, wozu gibt es noch Bibliotheken? Sie scheinen im digitalen Zeitalter anachronistisch zu sein.
Um den Wert und die Nützlichkeit einer wissenschaftlichen Bibliothek verstehen zu können, müssen wir uns anschauen, wer für den Bibliotheksbestand verantwortlich ist. Die Bücher werden nämlich von Experten nach den Kriterien ausgewählt, ob sie wissenschaftlich fundiert sind, ob die enthaltenen Informationen neue Erkenntnisse vermitteln und ob sie einen Themenkreis abdecken, der zum Sammelschwerpunkt der Bibliothek passt.
Ein wissenschaftlich fundiertes Werk, was ist das?

Foto: Sonja Hülsebus
Im Groben und Ganzen heißt dies erst einmal, dass das Buch von einem Wissenschaftler geschrieben und in einem wissenschaftlich renommierten Verlag veröffentlicht wurde. Im Detail bedeutet es, dass der Autor oder die Autorin sich an wissenschaftlichen Standards orientiert, d.h. Quellen werden offengelegt bzw. nichts wird ohne Nachweis behauptet. Ein renommierter Verlag in der Japanologie – das ist beispielsweise Harrassowitz oder der Iudicium Verlag – stellt an seine AutorInnen ebenfalls diese Ansprüche.
Im Internet kann jeder veröffentlichen! Informationen können ohne Nachweis und ohne Korrektur eingestellt werden. Das mag sehr demokratisch anmuten, ist aber für die Wissenschaft ein Problem. Der Leser muss die Richtigkeit der Information selbst bewerten und ggf. Quellen recherchieren. Natürlich gibt es auch im Internet Texte und Seiten, die wissenschaftlich fundiert sind. Die Unterscheidung und Einordnung muss man jedoch lernen.
Die Suchmaschine führt auf den richtigen Weg. Oder vielleicht nicht?
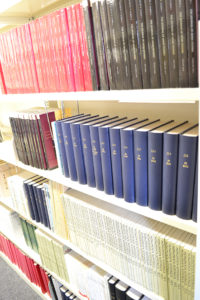
Foto: Sonja Hülsebus
Wer im Internet über die bekannten Suchmaschinen Informationen sucht, wird gezielt zu dieser geführt. Das ist praktisch. Aber es verstellt auch den Blick nach rechts und links. In einer thematisch sortierten Bibliothek wie der in der Japanologie kann man sich vor ein Regal stellen und hat viele Bücher vor sich, die für das Thema relevant sind. Sicherlich dauert es länger, aber meistens ist es auch ergiebiger und umfassender als sich von Google den Weg vorschreiben zu lassen.
Oder man kann eine bibliographische Datenbank benutzen – eine Suchmaschine für Wissenschaftler. Für Japanologen gibt es beispielsweise die „Bibliography of Asian Studies“, die von der Universitätsbibliothek zur Verfügung gestellt wird. Die Angaben dort führen zu digitalen Texte oder zu Büchern, die man in der Japanologie, in der USB oder manchmal auch anderorts bekommen kann.
Ist Wikipedia böse?

Foto: Sonja Hülsebus
Nein, Wikipedia ist toll! ABER: Für Hausarbeiten und Referate ist Wikipedia keine adäquate Quelle. Sicherlich gibt es gut recherchierte, wissenschaftlich richtige Artikel, aber es gibt eben auch andere. Um eine richtige Einschätzung abgeben zu können, muss man zum einen Erfahrung haben und zum anderen über das Thema bereits gut Bescheid wissen. Häufig stehen bei Wikipedia-Artikeln am Ende Literaturangaben. Diese ermöglichen auf jeden Fall einen guten ersten Einstieg in die Recherche und das Thema. Praktisch ist auch, dass viele Beiträge in verschiedenen Sprachen vorliegen. Man kann also ein Thema im Deutschen suchen und sich die wichtigen Schlüsselbegriffe z. B. im japanischen Beitrag ansehen.
Internet ist nicht gleich Internet.
Zum einen haben wir Webseiten, die nur im Internet existieren, die sich schnell ändern können und die jeder reinstellen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch zahlreiche Datenbanken, E-Books oder Zeitschriften. Häufig sind das Texte, die zuerst auf Papier veröffentlicht wurden und anschließend als digitale Version zur Verfügung gestellt werden. Wenn ein Text eingescannt und online gestellt wird, nennt man das ein Digitalisat. Zum Beispiel sind die Bücher bei Google Books Digitalisate von gedruckten Büchern. Dummerweise ist häufig die Seite, die man lesen möchte, nicht verfügbar. Das passiert in den gedruckten Büchern glücklicherweise höchst selten.
Die Bibliothek der Japanologie …

Foto: Sonja Hülsebus
… finden Sie im 4. Obergeschoss des Ostasiatischen Seminars. Hier können Sie sich vor ein Regal stellen und finden gleich viele Bücher, die zu Ihrem Thema passen. Wenn Sie ein Buch mal nicht finden, hilft die Bibliotheksaufsicht gerne weiter. Arbeitsplätze gibt es auch. Und haben Sie es erstmal so weit geschafft, bleibt der innere Schweinhund meistens vor der Tür.
Geöffnet von montags bis freitags, 10.00 bis 18.00 Uhr.
… man findet vieles im Internet …
…, aber eben nicht alles und nicht alles ist für das wissenschaftliche Arbeiten an der Universität brauchbar. Die Mischung macht’s!
Auf den Webseiten der Japanologie finden Sie zahlreiche Links zu Internetseiten, die für das wissenschaftliche Arbeiten geeignet sind.