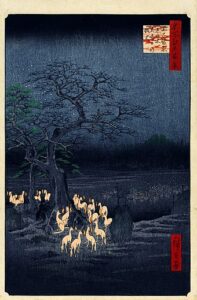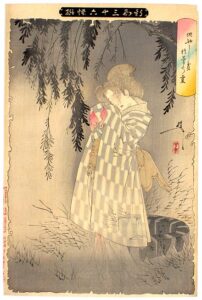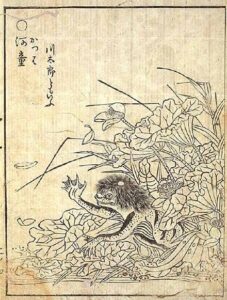Ground Zero Hiroshima – wie eine Atombombe das Stadtbild veränderte
Autorinnen: Melanie Kania und Çılga Merten
Während des Zweiten Weltkriegs wurden hunderte von Städten weltweit durch Bomben und Gefechte zerstört. Keine Stadt traf es jedoch so verheerend wie Hiroshima, auf das am 6. August 1945 die erste Atombombe abgeworfen wurde. Die Explosion und das daraus resultierende Feuer vernichteten nahezu jedes Gebäude der Stadt und forderten zehntausende Menschenleben. Die medizinische Versorgung brach vollständig zusammen und Krankheit sowie Verletzungen waren allgegenwärtig. Dennoch begannen die Überlebenden rasch mit dem Wiederaufbau der Stadt.
 Wurden zunächst nur provisorische Notunterkünfte errichtet, sahen die Stadtverwaltung und Architekten die Situation als eine Chance, die Stadt von Grund auf neu zu gestalten und wieder aufzubauen. Schon wenige Jahre nach der Zerstörung lag der Fokus der Planung nicht mehr nur auf der Wiederherstellung der Stadt, sondern auch auf der Wahrung der Erinnerung an den Abwurf der Atombombe und letztendlich der Etablierung des Bildes als Stadt des Friedens.
Wurden zunächst nur provisorische Notunterkünfte errichtet, sahen die Stadtverwaltung und Architekten die Situation als eine Chance, die Stadt von Grund auf neu zu gestalten und wieder aufzubauen. Schon wenige Jahre nach der Zerstörung lag der Fokus der Planung nicht mehr nur auf der Wiederherstellung der Stadt, sondern auch auf der Wahrung der Erinnerung an den Abwurf der Atombombe und letztendlich der Etablierung des Bildes als Stadt des Friedens.
Hierzu wurde ein Architekturwettbewerb ausgelobt, den 1949 der Architekt Tange Kenzô 丹下健三 (1913-2005) gewann. Die Stadtverwaltung hatte genaue Vorstellungen, wie die Stadt aussehen sollte und machte daher verschiedene Vorgaben – auch was das Budget und verschiedene Gebäuden wie eine Friedenshalle und eine Konferenzhalle anbelangte. Tange hatte schon zuvor an den Wiederaufbauplänen der Stadt mitgewirkt und demnach auch entsprechende Kenntnisse dieser Erwartungen. Er bezog die gesamte Stadt in seine Überlegungen ein und legte einen Entwurf vor, der viele Parks, Denkmäler und touristische Anlagen beinhaltete. Der von ihm entwickelte Plan, das Peace Park Project, wird auch als „Tange-Plan“ bezeichnet. Das Gebiet für Friedensdenkmäler und -bauten wurde bei der Umsetzung von Tanges Plänen jedoch deutlich reduziert. Folglich wurde nur ein Teil des Plans tatsächlich umgesetzt, sodass heutzutage die meisten Friedensobjekte im Stadtteil Nakajima zu finden sind.
Das zentrale Element des Projekts, welches auch umgesetzt wurde, war die Errichtung des Hiroshima Peace Memorial Parks oder auch Friedensgedenkparks. Er befindet sich überwiegend nahe dem Epizentrum der Explosion in der Mitte der Stadt auf einer Insel umgeben von einem Fluss. Im Park befinden sich zahlreiche Denkmäler und Gedenkstätten, die an den Schrecken der Atombombe erinnern und dem Wunsch nach Frieden Ausdruck verleihen sollen. Die Anlage ist so aufgebaut, dass drei architektonische Objekte auf einer Linie aufgereiht den Kern des Parks darstellen: Das Friedensgedenkmuseum, welches vor allem Ausstellungsstücke beinhaltet, die die Folgen der Atombombe vergegenwärtigen, das Kenotaph, ein Friedensdenkmal für die Opfer der Atombombe, und der sogenannte Atombombendom (genbaku dômu 原爆ドーム), der sich auf der anderen Seite des Flusses befindet. Diese Ruine ist eines der wenigen Gebäude, welche nicht vollständig von der Atombombe zerstört wurden. Es wurde 1996 als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt.
Im neuen Stadtbild des ehemaligen Stadtkerns Hiroshimas lassen sich zwei wichtige Arten von architektonischen Bauten feststellen: Zum einen gibt es die historischen Gebäude, allen voran die Atombombenkuppel, die in dem Zustand bewahrt werden, in dem sie nach dem Abwurf der Atombombe aufzufinden waren. Ihre Hauptfunktion ist es, Teile der Stadt zu memorialisieren, sie also wie ein Artefakt einer vergangenen Zeit zur Erinnerung zu nutzen. Zum anderen gibt es die neuen Gebäude und Denkmäler, die zu einem Großteil von Tange entworfen und in der Folge um neue Bauwerke erweitert wurden. Zu diesen zählen das Friedensgedenkmuseum und das Kenotaph. Diese sind ebenfalls darauf ausgerichtet, an die Vergangenheit und vor allen an die Opfer zu erinnern.
Auch wenn die Größe des heutigen Friedensgedenkparks nicht den ambitionierten Plänen Tanges entsprechen, gelang es Hiroshima, das neue Bild der Stadt erfolgreich zu festigen. Die Intention der gesamten Neugestaltung inklusive der Parkanlagen und Museen dient noch immer der Erinnerung und ist eine Aufforderung, den Frieden als oberstes Ziel der Menschheit anzusehen.

 Selbst der damaligen, faktisch kolonialen Herrschaft in Korea und Taiwan zum Trotz wollte sich das japanische Kaiserreich dabei nie als eine Großmacht verstanden wissen, die fremde Regionen ausbeutete. Das starke Bevölkerungswachstum und die zunehmende Industrialisierung in den 1920er-Jahren veranlassten Japan, seinen Einfluss zu vergrößern sowie Rohstoffe benachbarter Regionen zu importieren.
Selbst der damaligen, faktisch kolonialen Herrschaft in Korea und Taiwan zum Trotz wollte sich das japanische Kaiserreich dabei nie als eine Großmacht verstanden wissen, die fremde Regionen ausbeutete. Das starke Bevölkerungswachstum und die zunehmende Industrialisierung in den 1920er-Jahren veranlassten Japan, seinen Einfluss zu vergrößern sowie Rohstoffe benachbarter Regionen zu importieren. sogenannten Kaiserkronen-Stil (teikan yôshiki 帝冠様式) bedeckten Symbolbauten eine tragende Rolle in der Stadtplanung zu: Die Symbiose von traditioneller und westlicher Architektur sollte die nationale Identität Japans ausdrücken. Ein zentraler Platz, auf den sechs große Boulevards sternförmig zuliefen, erinnerte zudem an europäische Großstädte der Zeit, mit Parks und Grünanlagen rings umher.
sogenannten Kaiserkronen-Stil (teikan yôshiki 帝冠様式) bedeckten Symbolbauten eine tragende Rolle in der Stadtplanung zu: Die Symbiose von traditioneller und westlicher Architektur sollte die nationale Identität Japans ausdrücken. Ein zentraler Platz, auf den sechs große Boulevards sternförmig zuliefen, erinnerte zudem an europäische Großstädte der Zeit, mit Parks und Grünanlagen rings umher.
 Seit 2018 arbeiten die ersten Absolvent*innen des Kölner Lehramtsstudiengangs für Japanisch als reguläre Lehrkräfte an Schulen. Um die Unterrichtsbedingungen des Fachs besser einschätzen zu können, wurde daher von Januar 2022 bis Juli 2023 an der Universität zu Köln ein
Seit 2018 arbeiten die ersten Absolvent*innen des Kölner Lehramtsstudiengangs für Japanisch als reguläre Lehrkräfte an Schulen. Um die Unterrichtsbedingungen des Fachs besser einschätzen zu können, wurde daher von Januar 2022 bis Juli 2023 an der Universität zu Köln ein  In einem zweiten Schritt wurde mit einem Fragebogen ermittelt, wie die Schüler*innen ihr Lehrbuch finden und welche Wünsche sie an ein neues Lehrbuch haben. Dabei wurde deutlich, dass eigens für Schüler*innen erstellte Lehrmaterialien die Motivation auch dann verbessern, wenn das Lehrmaterial an sich graphisch und inhaltlich nicht so ansprechend gestaltet ist. Die Schüler*innen finden es wichtiger, dass die Materialien ihre Interessen und Themen berücksichtigen, als dass sie authentische Texte enthalten. Auch das Design ist für sie nicht so entscheidend, aber sie wünschen sich mehrheitlich farbige und abwechslungsreiche Materialien.
In einem zweiten Schritt wurde mit einem Fragebogen ermittelt, wie die Schüler*innen ihr Lehrbuch finden und welche Wünsche sie an ein neues Lehrbuch haben. Dabei wurde deutlich, dass eigens für Schüler*innen erstellte Lehrmaterialien die Motivation auch dann verbessern, wenn das Lehrmaterial an sich graphisch und inhaltlich nicht so ansprechend gestaltet ist. Die Schüler*innen finden es wichtiger, dass die Materialien ihre Interessen und Themen berücksichtigen, als dass sie authentische Texte enthalten. Auch das Design ist für sie nicht so entscheidend, aber sie wünschen sich mehrheitlich farbige und abwechslungsreiche Materialien.