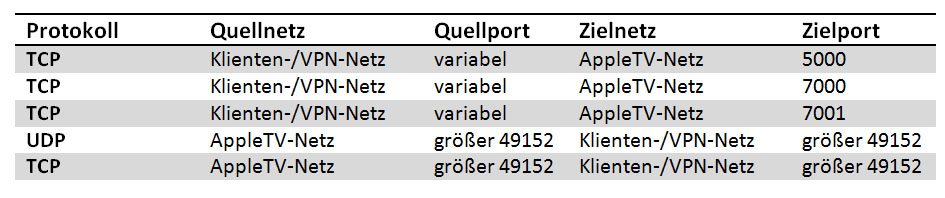Was ist Big Data?
Der Terminus „Big Data“ ist nun schon seit einigen Jahren auf dem Markt. Neuigkeiten wie der NSA-Skandal haben sicherlich dazu beigetragen, Aufmerksamkeit für den ganzen Themenkomplex zu wecken. Mögliche Konsequenzen der neuen Datenwelt, die ja ein wichter Teil der digitalen Transformation sind, werden inzwischen in den allgemeinen Medien ausführlich dargestellt und besprochen.
In den Wissenschaften, insbesondere in den Natur- und Lebens-, den Wirtschafts- und Sozial- aber auch in den Geisteswissenschaften, werden „Big Data“-Techniken als neue Arbeitsmethoden immer wichtiger. Grund genug, hier ein paar Überlegungen zu „Big Data“ und zur technologischen Basis anzustellen.
Der Begriff. Ganz grob gesprochen geht es bei „Big Data“ um die Verknüpfung verschiedener und umfangreicher Datenbestände. In der Hoffnung, neue Informationen bzw. Erkenntnisse gewinnen zu können, werden diese korreliert und analysiert; eine komplexe Jonglage also.
Google Trends verrät, dass seit 2009 „Big Data“ als Suchbegriff austritt und dann rasch relevanter wird. Die Methode ist im Kern nicht ganz so neu und baut ganz erheblich auf älteren Ansätzen wie Data Warehouse auf. Aber „Big Data“ ist eine umfangreiche Ansammlung verschiedener Technologien: Gartner hat einen eigenen Big Data Hype Cycle zusammengestellt, in dem das Thema in über drei Dutzend Teilgebiete differenziert wird. Trotzdem hat sich inzwischen eine allgemeine Charakterisierung für „Big Data“ entwickelt, welche um englische Begriffe kreist, die alle (mnemotechnisch günstig) mit einem V beginnen:
Die ersten drei Vs. Diese drei „klassischen“ Vs gehen auf einen steinalten Artikel von D. Laney aus dem Jahr 2001 zurück und heißen: Volume, Velocity und Variety.
Volume: Wie “Big Data” schon nahelegt, ist der schiere Umfang der verwendeten Daten eine wichtige Kenngröße. Während man heute sicherlich einige Terabyte (10^12) aufbieten können muss, treibt einige Leute schon die Sorge um, dass irgendwann die Präfixe knapp werden könnten und bringen Brontobytes (10^27) ins Gespräch …
Velocity (Schnelligkeit): Hiermit ist die Geschwindigkeit gemeint, mit der Daten erzeugt, verarbeitet und analysiert werden. Auch die Analyse während der Erzeugung, also eines Datenstroms, ist eine besondere Ausprägung dieses Merkmals.
Variety (Verschiedenheit): Die gemeinsame Verwendung von Daten aus unterschiedlichen Quellen sowie von strukturierten und unstrukturierten Daten ist ebenfalls typisch. Dies ist auch eine echte Weiterentwicklung des sehr strukturierten Data Warehouse Ansatzes.
Noch mehr Vs. Nach den genannten drei Vs kamen aber noch weitere Merkmale dazu:
Veracity (Wahrhaftigkeit): Dieses Charakteristikum greift den spannenden Umstand auf, dass auch Daten ausgewertet werden, die inkonsistent oder nicht sonderlich vertrauenswürdig sind. Man ahnt schon, dass dies ganz neue Herausforderungen mit sich bringt.
Variability (Veränderlichkeit): Diese besondere Ausprägung spielt eine Rolle, wenn Daten aus einer Sprachverarbeitung heraus verwendet werden. Dann kann sich die Bedeutung der Daten selbst verändern.
Visualisation (Veranschaulichung): Gerade die Analyse des Datenmaterials ist eine ziemliche Herausforderung. Der eingangs erwähnte WDR-Beitrag enthält auch ein paar mahnende Fehlinterpretationen, denen man ganz leicht aufsitzen kann. Für ein wirkliches Verständnis der „mutmaßlichen Befunde“, ist eine Veranschaulichung bereits in der Analyse unabdingbar. Zur Darstellung der Ergebnisse ist das weite Gebiet der Infographiken ein wichtiges Hilfsmittel. [1] [2] [3] [4]
Und noch ein V. Als siebtes (und bislang) letztes V findet sich
Value: Das ist eigentlich die „Sinnstiftung“ von Big Data, nämlich die Erinnerung, dass eine nützliche, wertvolle Erkenntnis am Ende der Übung stehen soll.
Weitere und ausführlichere Darstellungen finden sich im Web reichlich [5], [6].
Big Data = Technik + Algorithmik + Analytik? Die Charakteristiken von „Big Data“ scheinen mir nahe zu legen, dass hier drei Schichten zusammengebracht werden müssen, um ein fundiertes und werthaltiges Ergebnis zu erreichen:
- DieTechnik, welche die Voraussetzungen zur Haltung und Verarbeitung von Daten ist. Diese kann natürlich als Service im Sinn des Cloud-Paradigmas realisiert werden.
- Die Algorithmik, also die Konstruktion oder Wahl geeigneter Software zur Auswertung der Daten.
- Die Analytik, welche Hypothesen aus der Auswertung falsifiziert oder validiert, um ein Verständnis der Aufgabenstellung zu erreichen. Auf dieser Ebene ist die Semantik der Ergebnisse der dominierende Aspekt.
Die sieben Charakteristiken von Big Data sind nicht alle gleichermaßen auf diesen Schichten ausgeprägt. Vielmehr sind einige Schwerpunkte evident:
| Technik | Algorithmik | Analyse | |
| Value | Stark | ||
| Visualisation | Stark | ||
| Variability | Mittel | Stark | |
| Veracity | Stark | Stark | |
| Variety | Stark | Stark | |
| Velocity | Stark | Stark | |
| Volume | Stark | Mittel |
Dass sich die drei „klassischen Vs“ – Volume, Velocity und Variety – in der Technik- und Algorithmik-Schicht besonders deutlich niederschlagen, ist wenig überraschend. Bei Veracity und Variability steht schon per definitionem die Semantik der Daten im Mittelpunkt.
Nun noch ein paar Überlegungen zur Speicherung und dem Management von Daten im Big Data Kontext.
Big Data und die IT-Infrastruktur
Traditionelle Speicher-Architekturen. Das Speichern und Verwalten von Daten kann auf recht unterschiedliche Weise erfolgen. Auf einer ziemlich tiefliegenden Technikebene können beispielsweise „Block Devices“ genutzt werden, um Portionen von Bytes zu schreiben und zu lesen. Das ist flexibel und performant, aber mühselig und eher für Experten geeignet. Anwender arbeiten normalerweise mit Dateisystemen oder auch (im Fall hochgradig strukturierter Daten) relationalen Datenbanken. Dateisysteme organisieren die einzelnen Dateien in einer Hierarchie und bieten oft Features wie Zugriffsteuerung, Versionierung, Replikation. In der Big Data Welt wird aber immer häufiger von Objekt-Speicher gesprochen, der die guten alten Filesysteme ablösen wird. Warum wird das so sein?
Objekt-Speicher. Das Konzept des Objekt-Speichers beruht auf dem Ansatz, die Details der Speicherung wie etwa Speicherort zu verbergen. Mit dem Speicherobjekt kann nur über eine definierte, schlanke Schnittstelle interagiert werden. Konkret besteht das Speicherobjekt aus einer eindeutigen Identitätskennung (ID), Metadaten, einer Menge von Standardmethoden (in der Regel ein API mit den CRUD-Aktionen – und häufig Accounting für die Cloud) sowie dem eigentlichen Dateninhalt. Das unterscheidet sich sehr erheblich vom Filesystem: Da der Speicherort verborgen ist, gibt keine Hierarchie (sondern nur die ID). Raffinierte, mächtige Features sind im Objekt-API nicht implementiert.
Das klingt auf den ersten Blick nicht besonders verlockend. Allerdings kommen mit diesem Ansatz auch Vorteile:
- Der Zugriff über eine ID und ein API ist einfach zu standardisieren. Verschiedene Speicher können dann gleichartig genutzt werden.
- Der Umgang mit Datenobjekten über ein API, also von einer Anwendung aus, ist grundsätzlich einfacher als das hantieren mit Dateien. Dabei muss nämlich mit dem Betriebssystem eines Servers oder aber einem Netzwerkprotokoll interagiert werden, was typischerweise ziemlich komplex und variantenreich ist.
- Die Objekt-Metadaten können im Prinzip erweitert werden, was Dateisysteme meist nicht vorsehen.
- Das Datenmanagement kann erheblich flexibler und weitreichender agieren, weil der Speicherort vor den Nutzenden verborgen ist. Dadurch können mehr steuernde und optimierende Eingriffe transparent durchgeführt werden.
- Im Zusammenspiel mit den Objekt-Metadaten kann das Datenmanagement besser automatisiert werden. Bei Filesystemen ist dies nur bei speziellen HSM-Lösungen möglich.
- Durch die Entkopplung von Nutzung und Management können horizontal skalierende Lösungen (scale out) einfacher realisiert werden.
Vorteile sind also sowohl in der Datennutzung als auch im Datenmanagement zu erwarten, wobei es hauptsächlich um Standardisierung, Automatisierung und Flexibilisierung geht.
Volume, Velocity, Variety und Speicher-Objekte. Bezüglich Volume und Velocity sind die Vorteile des Objektspeichers bezüglich des Datenmanagements (also 4, 5 und 6) relevant. Bei riesigen Datenmengen mit erheblichen Veränderungsraten wird die Transparenz und Automatisierung von Management-Aktivitäten immer wichtiger, da dies Einschränkungen bei der Verfügbarkeit reduziert und einen „smarten“ Umgang bei Lastwechseln ermöglicht.
Während die Nutzenden stärker von Fragen der Kapazitätsplanung entlastet werden können, verbleibt ihnen die Bürde des Umgangs mit den unterschiedlichen Datenquellen. Die Komplikationen, die sich aus der Variety ergebenen könnten, werden beim Objekt-Speicher aber durch die einfachere und einheitliche Schnittstelle aus ID und API (also 1, 2 und 3) entschärft.
Für die interaktive Standardnutzung im Büroalltag werden Filesysteme sicherlich weiterhin ihre Bedeutung behalten, denn dort ist die hierarchische Organisation oft sehr sachgemäß. Für die Nutzung von Speicherbeständen aus Anwendungen heraus, welche diese dann komplexe Analysen in diesen Beständen durchführen, sind Objekt-Speicher aber zweifellos die bessere Wahl.
Es wird spannend sein, wie sich Nachfrage und Angebot in den nächsten Jahren an unserer Universität entwickeln werden. Gartner gelangt übrigens zu dem Schluss, dass Big Data im Jahr 2014 die Hype-Cycle-Phase des „Trough of Disillusionment“ erreicht hat. Good Luck, Big Data!
Weitere Informationen
Provost, F.; Fawcett, T.: Data Science for Business; O’Reilly; 2013