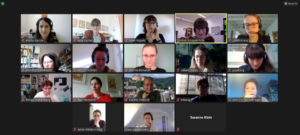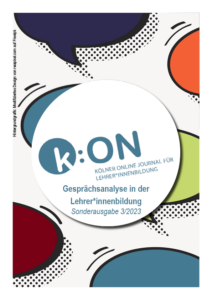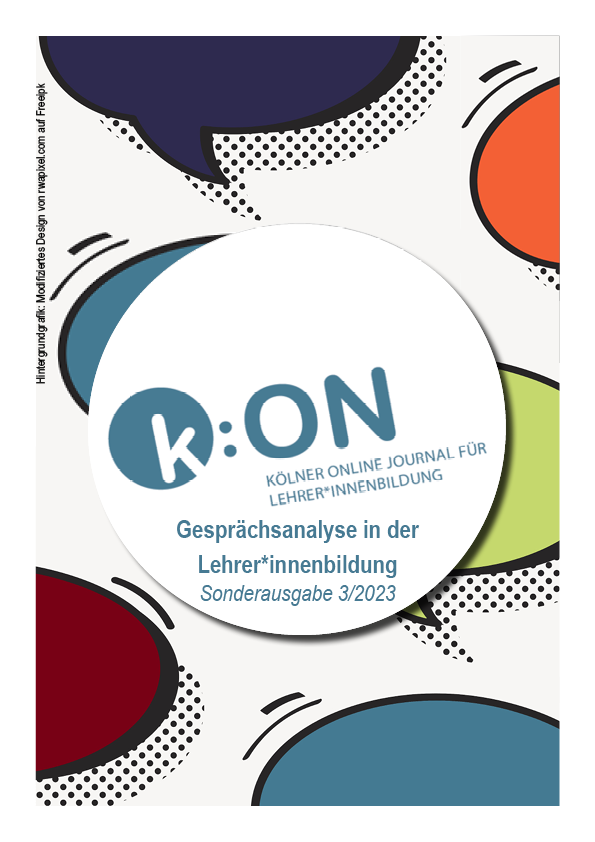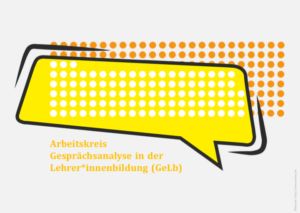DiDa AK GeLb_SoSe 25-Programm
Wir freuen uns, die nunmehr neunte Runde der Digitalen Datensitzungen des AK GeLb
anzukündigen.
Im Sommersemester 2025 finden erneut „klassische“ Datensitzungen statt, an denen Kolleg*innen Material aus aktuellen Projekten zur Diskussion stellen.
Wir freuen uns auf ein weiteres, produktives Semester!
Fr., 09.05.25 | 09.30-11.00 | Martin Schastak (DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und -information, Individual Development and Adaptive Education (IDeA), Frankfurt/Main)
„Can we now let mum read a little more?“ Aushandlung der Rezeption sprachenseparierender und -integrierender bilingualer Bilderbücher beim gemeinsamen (Vor-)Lesen im familiären Kontext
Während für Bilderbücher bereits eine Tradition der gemeinsamen Rezeption in Familien vorliegt, spielen Bilderbücher in der Grundschule bisher kaum eine Rolle, obwohl sie sich zur Förderung einer Vielzahl von Kompetenzen (vgl. Abraham & Knopf 2018) sowie zur Verbindung unterrichtlicher und familialer (Vor-)Lesepraktiken (vgl. Schastak & David-Erb, 2023) eignen. Für mehrsprachige Familien stellen mehrsprachige Bilderbücher vielversprechende Materialien für die familiäre Lesepraxis in mehrsprachigen Familien dar, die diverse Praktiken des Translanguagings
ermöglichen, insbesondere da sprachenseparierende und -integrierende Bilderbücher verschiedene Formen des Translanguagings nahelegen. Diese Praktiken werden bei der gemeinsamen Rezeption mehrsprachiger Bilderbücher von Grundschülerinnen und ihren Eltern durch sich aufdrängende Fragen nach der Aufteilung der Leseaufgaben und Sprachen beeinflusst, die es vor und bei der Rezeption zu verhandeln gilt. In dieser Studie werden die Rezeptionsweisen und Aushandlungsprozesse zur Verteilung von Leseaufgaben und Sprachen von n=6 Dyaden/Triaden bestehend aus bilingual deutsch-englischsprachig aufwachsenden Grundschülerinnen und ihren Müttern während der gemeinsamen Bilderbuchrezeption eines sprachenseparierenden und eines -integrierendes bilingualen deutsch-englischsprachigen Bilderbuches mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) sowie der Konversationsanalyse nach Deppermann (2008) untersucht. Die Interaktionen der Dy- und Triaden wurden vom Autor nicht-teilnehmend beobachtet, auditiv aufgezeichnet und ausgewählte Interaktionen transkribiert. Im Arbeitskreis sollen ausgewählte Aushandlungsprozesse von einer bilingualen Dyade (Englisch und Deutsch) und einer trilingualen Triade (Türkisch, Englisch, Deutsch) zur Verteilung von Leseaufgaben und Sprachen mithilfe der Gesprächsanalyse gemeinsam interpretiert werden.
Fr., 04.07.25 | 09.30-11.00 | Celina Tschiedel (Universität Bielefeld)
Partizipation autistischer Schüler*innen in inklusiven Unterrichtssettings
Während neurotypische Schülerinnen etablierte Muster von Gestik, Mimik, Körperhaltung und Blickverhalten nutzen, um Bedeutung zu vermitteln und ihr (Dis-)Engagement auszudrücken, zeigen autistische Kinder häufig inkongruente oder schwer interpretierbare Beteiligungssignale (Buttlar, Heller & Kern, 2018). Dies kann zu Missverständnissen im schulischen Alltag führen und die soziale Partizipation erschweren (Heasman & Gillespie, 2018; Wiklund, 2016). Studien belegen, dass autistische Kinder seltener an schulischen Aktivitäten partizipieren als ihre neurotypischen Peers (Mamas et al., 2021). Allerdings ist bislang wenig darüber bekannt, welche kommunikativen Mechanismen diese Partizipation beeinflussen. Das Datenkorpus, aus dem in der Datensitzung am 04.07.25 Ausschnitte präsentiert und diskutiert werden, umfasst authentische Interaktionen autistischer Kinder im schulischen Kontext. Im Mittelpunkt steht eine detaillierte Untersuchung der verkörperten Praktiken autistischer Schülerinnen sowie der Reaktionen ihrer neurotypischen Peers
und Lehrkräfte, um ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie kommunikative Mechanismen Partizipation im schulischen Alltag fördern oder behindern können. Methodisch wird hierfür eine konversationsanalytisch inspirierte multimodale Interaktionsanalyse angewendet, die eine differenzierte Betrachtung sozialer Interaktionen ermöglicht (Mondada, 2014).
Interessierte Kolleg*innen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen!
Die einzelnen Termine finden über Zoom/WebEx statt. Bitte melden Sie sich bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin über akgelb-orga@uni-koeln.de an;
Sie bekommen die Zugangsdaten dann per E-Mail zugeschickt.
__
Achtung: Im WiSe wird es keine Datensitzungen geben!
__
DiDa AK GeLb_WiSe 24/25-Programm
Digitale Datensitzungen (DiDa) – Eine Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises
In der 8. Runde der Digitalen Datensitzungen des AK GeLb im Wintersemester 2024/2025 sind wieder drei „klassische“ Datensitzungen geplant, an denen Kolleg*innen Material aus aktuellen Projekten zur Diskussion stellen.
Fr., 08.11.24 | 09.30-11.00 | Juliane Götz (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
„Can you say that in English?“ – Code-Switching im mitteilungsbezogenen Unterrichtsgespräch im Englischunterricht
Das bewusste Einsetzen der Mutter- bzw. Mediumssprache im Sinne einer aufgeklärten Einsprachigkeit im Fremdsprachenunterricht verlangt von Lehrpersonen und Lernenden nicht nur zielsprachliche, sondern auch interaktionale Fertigkeiten. Diese Herausforderung verstärkt sich mit dem Anspruch, Kommunikationsanlässe zum
mitteilungsbezogenen Sprechen zu schaffen, welche Räume zur Mitgestaltung des Diskurses für Lernende eröffnen und außerdem Möglichkeiten zur Ausbildung zielsprachlicher Kompetenzen bieten. Im Rahmen meines Promotionsprojektes untersuche ich die Fertigkeiten der Gesprächsführung (Classroom Interactional Competence nach Walsh (u. a. 2008)) und die Nutzung typischer Interaktionsmuster von Lehramtsstudierenden im Englischunterricht durch eine gesprächsanalytische Betrachtung von Lehrer:in-Schüler:innen-Interaktionen in den ersten Unterrichtsversuchen. Neben einer Analyse bekannter Phänomene in Unterrichtsgesprächen, wie Wait Time, Schüler:inneninitiativen oder Follow-Up-Moves, fokussiere ich auch die Nutzung von Code-Switching zur Herstellung eines gemeinsamen Verständnisses im Sinne einer Ko-Konstruktion von Gesprächen. Konkret sollen die Daten offenlegen, wie Sprachwechsel in mitteilungsbezogenen Lehrer:in-Schüler:innen-Interaktionen strukturiert sind, welche Funktionen sie erfüllen und wie die Studierenden diese in den laufenden Diskurs einbetten.
_Walsh, S. (2008): Investigating Classroom Discourse. Reprint. Domains of Discourse. London: Routledge.
Fr., 06.12.24 | 09.30-11.00 | Lisa Vössing (Universität Bielefeld)
Kommunikativ-pragmatische Kompetenzen autistischer Kinder in alltäglichen Interaktionen
Auffälligkeiten in der Kommunikation sind kennzeichnend für das Autismus-Spektrum. Dabei zeigen sich große interindividuelle Varianzen hinsichtlich möglicher Auffälligkeiten (Volden, 2017). Für die Erfassung kommunikativ-pragmatischer Kompetenzen bei Kindern stehen unterschiedliche methodische Vorgehensweisen zur Verfügung. z. B. informelle Diagnostikverfahren, standardisierte Tests, Checklisten, Beobachtungsbögen oder Interviewleitfäden (Spreer & Sallat, 2015). Bei diesen Vorgehensweisen fehlt jedoch eine detaillierte Betrachtung kommunikativ-pragmatischer Kompetenzen auf der Grundlage natürlicher Interaktionen (alltäglicher Gesprächssituationen). Das Datenkorpus, aus dem Ausschnitte in der Datensitzung am 06.12.2024. präsentiert und diskutiert werden sollen, umfasst alltägliche Interaktionen autistischer Kinder im familiären und therapeutischen Kontext. Im Fokus des Interesses steht die Rekonstruktion interaktiver Phänomene, in denen sich kommunikativ-pragmatische Kompetenzen zeigen.
_Volden, J. (2017): Autism Spectrum Disorder. In: Research in Clinical Pragmatics, S. 59-83.
_Spreer, M. & Sallat, S. (2015): Pragmatikdiagnostik im Kindesalter. Überblick über einen vernachlässigten Bereich der Sprachdiagnostik. In: Forum Logopädie, Heft 3 (29), S. 12-19.
Fr., 10.01.25 | 09.30-11.00 | Clara Finke (Universität Leipzig)
Kommunikatives Handeln von Schulleitungen
Funktion und Kompetenzen von Schulleitungen haben sich über die Jahre stark gewandelt. Zu tradierten Aufgabenfeldern kommen immer neue hinzu. ‚Gute, zielführende Kommunikation‘ ist dabei Kernaufgabe. Im Forschungsprojekt wird Schulleitungshandeln aus kommunikativer Perspektive untersucht. Es wird danach gefragt, welche „kommunikativen Räume“ (vgl. Finke 2023) Schulleitungen bedienen müssen und welche kommunikativen Aufgaben und Anforderungen damit an sie gestellt werden. Das analytische Vorgehen ist als Mixed-Methods-Ansatz angelegt: Zunächst wurden 200 Schulleitungen im Sinne einer inhaltsanalytischen „Bedarfsanalyse“ (vgl. Huber 2010) online befragt, um relevante Themen, Probleme und Herausforderungen sowie Qualifikationen und ggf. damit zusammenhängende Desiderata zu eruieren. Anschließend wurden Daten mittels Gruppendiskussionsverfahren (vgl. Kupetz 2022) mit Schulleitungen erhoben. Die Ergebnisse werden gesprächsanalytisch in Bezug auf berufsbezogenes Routinewissen sowie die konkrete Ausgestaltung individuellen kommunikativen Handelns (Gesprächsstrukturen, kommunikative Praktiken etc.) ausgewertet. Im Rahmen der Datensitzung sollen erste Ergebnisse vorgestellt und diskutiert werden.
_Finke, C. L. (2023): Kommunikative Räume von Schulleitungen. In García García et al. (Hg.): k:ON – Kölner Online Journal für Lehrer*innenbildung. Sonderausgabe 3, S. 20-41. https://doi.org/10.18716/ojs/kON/2023.s3.2
_Huber, S. G. (2010): Schulleitung international. In Bohl et al. (Hg.): Handbuch Schulentwicklung. Theorie – Forschungsbefunde – Entwicklungsprozesse – Methodenrepertoire, S. 213-221.
_Kupetz, M. (2022): Invoking Personal Experience and Membership Categorie: Syrian Students’ Tellings in Focus Groups. In: Filipi, A., Ta, B. T. & Theobald, M. (Hrsg.): Storytelling Practices in Home and Educational Contexts. Perspectives from Conversation Analysis. Singapur: Springer, S. 225-252.
Interessierte Kolleg*innen sind herzlich zur Teilnahme an den DiDas eingeladen!
Wir freuen uns auf den spannenden Austausch!
__
DiDa AK GeLb_SoSe 24-Programm
Digitale Datensitzungen (DiDa) – Eine Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises
Wir freuen uns, die nunmehr siebte Runde der Digitalen Datensitzungen des AK GeLb
anzukündigen!
Im Sommersemester 2024 finden erneut „klassische“ Datensitzungen statt, an denen Kolleg*innen Material aus aktuellen Projekten zur Diskussion stellen.
Fr., 17.05.24 | 09.30-11.00 | Naiara Kohlmann (Georg August-Universität Göttingen)
„Aber ich bin hier geboren“ – nationale und soziale Identitäten von Online-Diskussionen im Rahmen eines Virtual Exchange
Fr., 21.06.24 | 09.30-11.00 | Lisa Mehmel (Universität Kassel)
Interaktive Deutungsentwicklung in Unterrichtsgesprächen über Bilderbücher mit hohem Polyvalenzgrad
Fr., 05.07.24 | 09.30-11.00 | Sören Ohlhus & KrisVna Matschke (Universität Hildesheim)
Texte in der Unterrichtsinteraktion
Wir freuen uns auf ein weiteres produktives Semester!
__
García Garciá, M.; Leßmann, A.-C.; Sacher, J. & Winterscheid, J. (Hrsg.) (2023): Gesprächsanalyse in der Lehrer*innenbildung. 3. Sonderausgabe von k:ON – Kölner Online-Journal für Lehrer*innenbildung. DOI:10.18716/ojs/kON/2023.s4.1
Mit Beiträgen von Clara Luise Finke, Judith Kreuz, Cordula Schwarze, Lesya Skintey, Miriam Morek, Nina Gregori und Björn Stövesand
Wir wünschen Euch eine spannende Lektüre!
__
DiDa AK GeLb_WiSe 23/24 Programm
Digitale Datensitzungen (DiDa) – Eine Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises
Die nunmehr sechste Runde der Digitalen Datensitzungen des AK GeLb widmet sich im Wintersemester 2023/24 den verschiedenen „threshold concepts“, die wiederkehrend in der hochschulischen Vermittlung gesprächsanalytischer Methoden manifest werden.
Die drei Termine sind als Werkstätten angelegt, zu denen best-/good-practice-
Materialien mitgebracht, von eigenen Erfahrungen berichtet werden und auch
gerne neu entwickelte Materialien vorgestellt werden können.
Fr., 10.11.23 | 09.30-11.00 | Normativität und die „analytische Mentalität“
Fr., 15.12.23 | 09.30-11.00 | Transkript
Fr., 19.01.24 | 09.30-11.00 | Multimodalität und „Körpersprache“
Wir freuen uns auf ein weiteres produktives Semester!
__
DiDa AK GeLb_SoSe 23_Programm und Abstracts
Digitale Datensitzungen (DiDa) – Eine Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises
An zwei Terminen im Mai und Juni wird es um hochschul- und methodendidaktische Fragen rund um die Gesprächsanalyse in der Lehre gehen.
Wir freuen uns, Euch in hoffentlich großer Zahl digital wiederzusehen, und freuen uns auf spannende und inspirierende Diskussionen zu Seminarideen!
Fr., 16.06.23 | 09.30-11.00 | Lesya Skintey, Universität Koblenz
Nutzung der Gesprächsanalyse zur Sensibilisierung von Studierenden für Interaktionen im Kontext von DaF*Z und Mehrsprachigkeit
Fr., 07.07.23 | 09.30-11.00 | Kristina Matschke, Universität Hildesheim
Werkstatt: Gesprächsanalyse in der Lehrer*innenbildung – Seminarkonzeptionen auf dem Prüfstand
__
K:ON-Themenheft „Gesprächsanalyse in der Lehrer*innenbildung“
Nach knapp vier Jahren AK GeLB, zwei Workshops, Konferenz- und Symposiumsbeiträgen und vier Semestern mit überaus vielfältigen und spannenden Digitalen Datensitzungen wollen wir die bisherigen Überlegungen zum Einsatz gesprächsanalytischer Methoden im Kontext der Lehrer*innenbildung in Form eines Publikationsprojekts bündeln. Wir laden daher die Mitglieder des Arbeitskreises herzlich dazu ein, Beiträge zu unserem geplanten Themenheft „Gesprächsanalyse in der Lehrer*innenbildung“ beizusteuern!
Kontaktadresse für Fragen usw.: akgelb-orga@uni-koeln.de.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und das Themenheft!
__
DiDa AK GeLb_WiSe 22/23
Digitale Datensitzungen (DiDa) – Eine Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises wurde in diesem Semester ausgesetzt.
Stattdessen gibt es einen Austauschtermin am 20.01.2023 (09:30-11:00 Uhr)
Anmeldung bitte unter: https://uni.koeln/9DUH2.
__
Digitale Datensitzungen (DiDa) – Eine Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises
Wir freuen uns, die nunmehr vierte Runde der Digitalen Datensitzungen des AK GeLb
anzukündigen!
Diese steht im Sommersemester 2022 unter dem Oberthema „Mündlichkeit im Sprach(en)unterricht“.
An drei Terminen präsentieren und diskutieren Kolleg*innen Daten und Ergebnisse aus aktuellen Forschungsprojekten.
Wir freuen uns auf ein weiteres, produktives Semester!
Fr., 06.05.22 | 09.30-11.00 | Marta García García, Georg-August-Universität Göttingen
„weil es halt schwieriger ist zu reden, als es einfach selber zu machen“ – Chancen und Herausforderungen von Escape-Rooms für die Förderung der mündlichen Interaktion im Fremdsprachenunterricht
Fr., 03.06.22 | 09.30-11.00 | Juliane Götz, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Unterrichtsgespräche im Englischunterricht – eine gesprächsanalytische Untersuchung von Lehrer:in-Schüler:innen-Interaktion in den ersten Unterrichtsversuchen
Fr., 01.07.22 | 09.30-11.00 | Anna-Lena Wagner, Universität Turin
Gesprochene Sprache in der mündlichen Produktion von DaF- und IaF-Lernenden
__
Digitale Datensitzungen (DiDa) – Eine Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises
Wir freuen uns, die nunmehr dritte Runde der Digitalen Datensitzungen des AK GeLb anzukündigen! Diese steht im Wintersemester 2021/22 unter dem Oberthema „Gesprächsanalytische Perspektiven auf ethnographisch-interaktionsanalytisches Arbeiten in der Lehrer*innenbildung“. An drei Terminen präsentieren und diskutieren Kolleg*innen Daten und Ergebnisse aus aktuellen Forschungsprojekten. Wir freuen uns auf ein weiteres, produktives Semester!
Die einzelnen Termine finden über Zoom/WebEx statt. Bitte melden Sie sich bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin über ak-gelb@uni-halle.de an; Sie bekommen die Zugangsdaten dann per E-Mail zugeschickt.
Fr., 26.11.21 | 09.30-11.00 | Julia Sacher, Universität zu Köln
Zwischen „verwirrend“ und „echt interessant“: Potenziale von Transkriptarbeit im Lehramtstudium
Fr., 17.12.21 | 09.30-11.00 | Björn Stövesand, Universität Bielefeld (krankheitsbedingt ausgefallen – Nachholtermin ist der 04.03.2022)
Going/Being native vs. Deskwork – Zur Rolle von Feldwissen und Felddeutungen in studentischen Analyseinteraktionen vor dem Hintergrund eines ethnographischen Fremsheitsbegriffs
Fr., 28.01.22 | 09.30-11.00 | Marina Bonanati, Philipps-Universität Marburg
Studentische Perspektive auf schulische Gespräche un deren Interpretation
__
Nach einem spannenden und produktiven ersten Durchlauf im Wintersemester freuen wir uns, auch im Sommersemester 2021 vier Termine für digitale Datensitzungen (DiDa GeLB) anzukündigen. Die einzelnen Termine finden über Zoom/WebEx statt. Bitte melden Sie sich bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin über ak-gelb@uni-halle.de an; Sie bekommen die Zugangsdaten und Materialien (Handouts, Transkripte etc.) dann per E-Mail zugeschickt.
Fr., 30.04.21 | 09.30-11.00 | Anna Carolina Oliveira Mendes & Taiane Malabarba, Universität Potsdam; JoseaneDe Souza, Federal University of Santa Caterina; Revert Klattenberg, Universität Hildesheim
Negotiating participation in video-mediated language teaching
Fr., 21.05.21 | 09.30-11.00 | Nina Gregori, Pädagogische Hochschule Zug
Bedingunen einer ‚interaktionsanalytisch ausgerichteten Fachdidaktik‘ in der Schulpraxis
Fr., 18.06.21 | 09.30-11.00 | Maxi Kupetz & Elena Becker & Helen Nikolay, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Translanguaging in Unterrichtsinteraktion als Gegenstand fallbasierter Lehrer*innenbildung
Fr., 09.07.21 | 09.30-11.00 | Clelia König, Universität Koblenz-Landau
Sprachförderung bei Kindern im Vorschulalter: Ressourcen analysieren, Potentiale entdecken
—
Digitale Datensitzungen (DiDa) – Eine Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises
Die einzelnen Termine finden über Zoom/WebEx statt. Bitte melden Sie sich bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin über ak-gelb@uni-halle.de an; Sie bekommen die Zugangsdaten dann per E-Mail zugeschickt.
Fr., 13.11.20 | 09.30-11.00 | Carmen Konzett-Firth, Universität Innsbruck
Beteiligung von Schüler*innen an der Herstellung von Intersubjektivität und Progressivität: Die Entwicklung von L2-Interaktionskompetenz im plenaren Unterrichtsgespräch
Fr., 04.12.20 | 09.30-11.00 | Judith Kreuz, Pädagogische Hochschule Zug
„aber was macht dir spAss; probiert immer ein konkretes BEIspiel zu sAgen.“ – Zur Etablierung und interaktiven Aushandlung von sozialen und sprachlichen Regeln im Klassenrat
Fr., 22.01.21 | 09.30-11.00 | Miriam Schöps, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Zur interaktionalen Hervorbringung von Verstehen im systemorientierten Geographieunterricht
Fr., 26.02.21 | 09.30-11.00 | Marina Bonanati, Goethe Universität Frankfurt am Main
Interpretation und Reflexion – Gesprächsanalytische Praktiken studentischer Kleingruppen
—
Vorstellung eines neuen Arbeitskreise „Arbeitskreis Gesprächsanalyse in der Lehrer*innenbildung (GeLb)“
8. bis 9. November 2019 in Basel
—
GeLb-Werkstatt II
„Gesprächsanalytisch arbeiten in der Lehrer*innenbildung“
25. Oktober 2019 in Bielefeld
Programm
—
Organisation des Panels „The multimodal constitution of learning space“ (Maxi Kupetz und Julia Sacher)
2. bis 5. Juli 2019 in Mannheim
—
„Unterrichtsinteraktion im Fokus – fächerübergreifende Relevanzen gesprächsanalytischer Arbeit in der Lehrer*innenbildung“
27. Juni 2019 in Halle/Saale
—
GeLb-Werkstatt
„Gesprächsanalytisch arbeiten in der Lehrer*innenbildung“
13. Juni 2019 in Bielefeld
Programm
—
Kick-Off-Treffen des Arbeitskreises
20. April 2018 in Halle/Saale